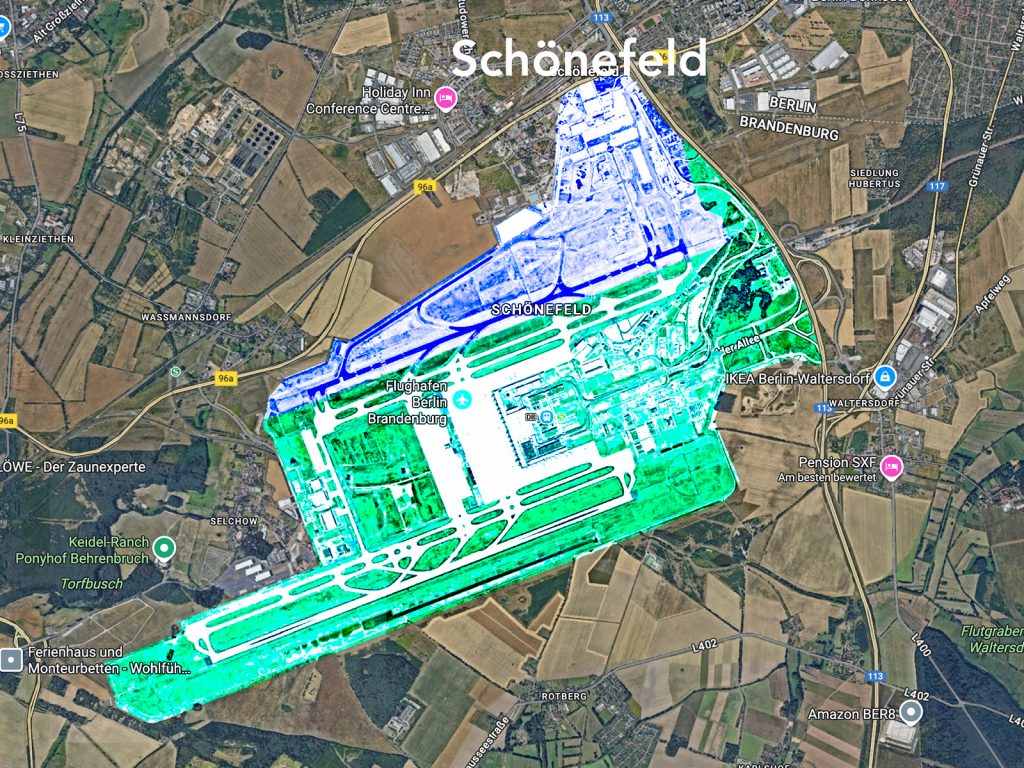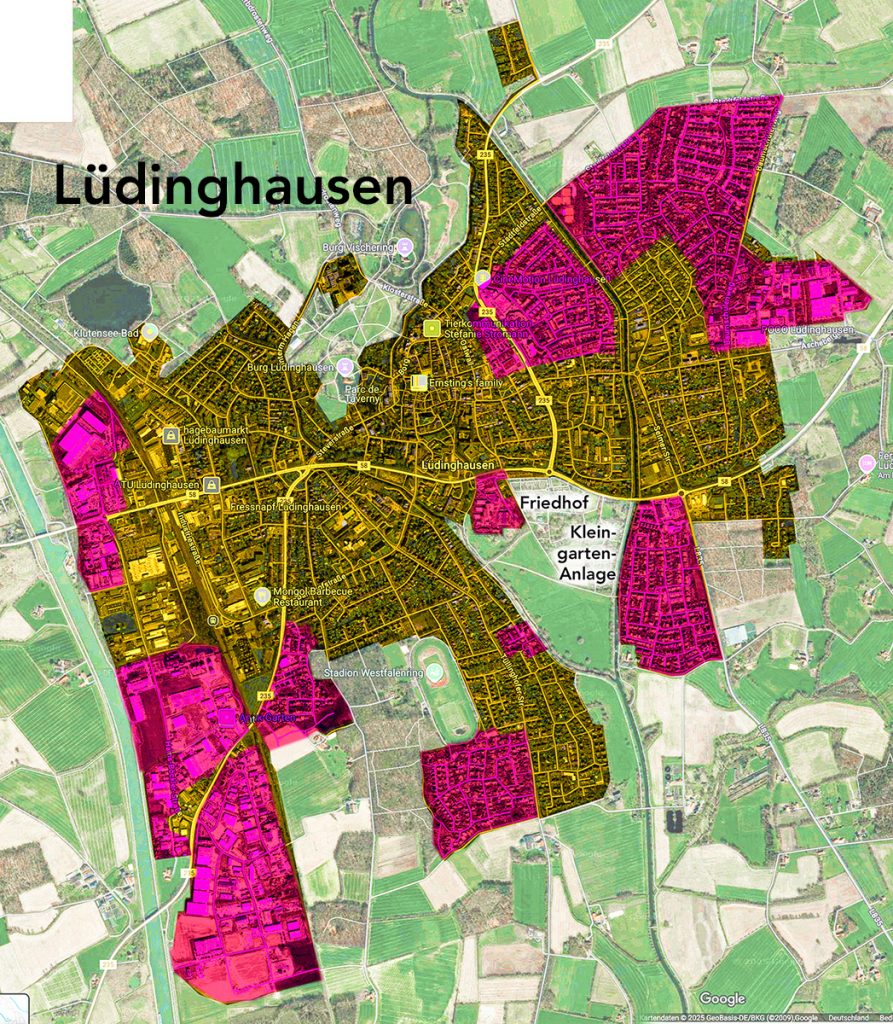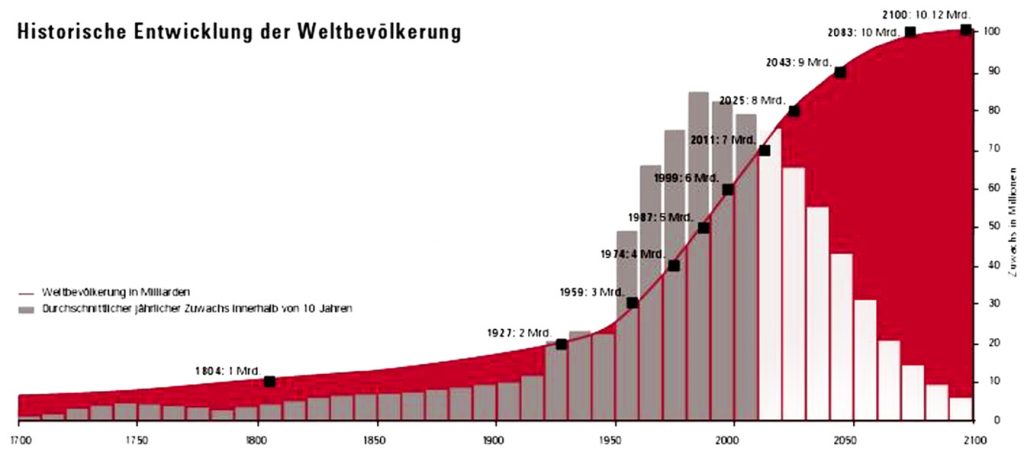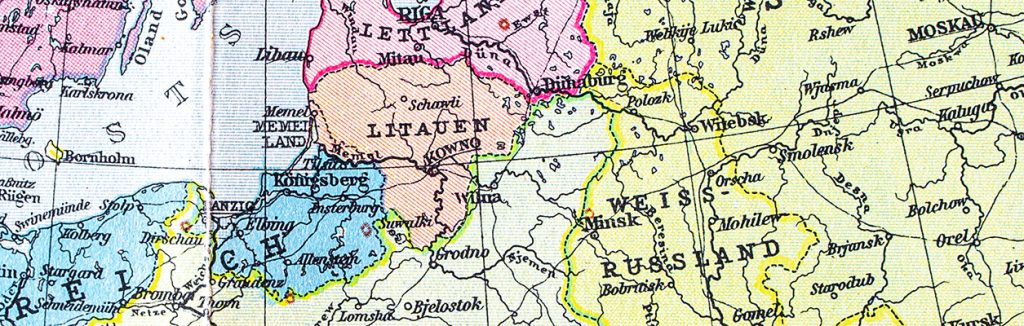Aus aktuellem Anlass heraus möchte ich mein Kapitel „Die Schweigespirale“ hier einmal in Auszügen wiedergeben – dem letzten Kapitel aus meinem Buch „Durch die Raumakustik muss ein Ruck gehen“ (2022). Dieses Buch ist keine Fachpublikation, sondern ein Sachbuch – mit dem ich mich aber auch immer wieder auf die Suche danach begebe, weshalb sich die Ergebenheit gegenüber Richtlinien und Verfahrensweisen so hartnäckig halten und auch so hartnäckig verteidigt werden, obwohl sie physikalisch keinen Sinn machen.
» […]
Die Tatsache, dass sich die Sozialpsychologie des Themas der Schweigespirale angenommen hat, ist wiederum ein eigenes Problem, das ich noch anschneiden werde. Kümmerte sich nämlich die Individualpsychologie darum, so kämpfte man möglicherweise nicht so bemüht um Größe und Reichweite des Begriffs der „öffentlichen Meinung“ – sondern könnte näher beim eigentlichen, individuellen Druck der „sozialen Kontrolle“ bleiben.
[…]
[…] Sabine Hossenfelder […], die da sagt, Wissenschaftler sollten berücksichtigen, „wie ihre Mitgliedschaft in einer Gruppe die Objektivität beeinträchtigen kann“.
Die eigene Objektivität? Die des einzelnen Wissenschaftlers? Oder die der Gruppe gegenüber Meinungsführerschaft? – Es handelt sich nicht um die Äquivalenz in einer mathematischen Formel. Es geht um Wechselwirkung. Beides gilt also.
Nicht zuletzt eine DIN 18041 profitiert von der Sprachlosigkeit in der Branche. Und über diese Sprachlosigkeit gelange ich zu jener Schweigespirale…
Eine Sprachlosigkeit, die tatsächlich daraus resultiert, dass der physikalischen Wissenschaft bisher Antworten auf die wesentlichste Frage der Raumakustik nicht gelungen ist: Woher rühren die akustischen Probleme in geschlossenen Räumen?
Nicht nur „draußen“, also dort, wo konkrete Probleme mt Lärm in geschlossenen Räumen zu lösen sind, sondern auch unter den Wissenschaftlern scheint es so zu sein, dass, wer keine plausiblen Antworten bieten kann, lieber schweigt. Oder mit den Wölfen heult.
Wer vernehmlich aufbegehrt gegen das Credo von der Absorption, mit der Nachhallzeiten getrimmt und kurz gehalten werden, läuft Gefahr, vorgeführt zu werden wie ein Makake im Zirkus.
So sehr Hossenfelder’s Kritik und Erklärungen für dieses Verhalten von Wissenschaftlern nachvollziehbar erscheinen, so sehr erstaunen sie: Die Profession des Wissenschaftlers ist, Neues zu entdecken. […]
Insbesondere aber unter Auftragnehmern, und sogar unter Herstellern von Produkten (zugegeben: die wiederum – je nach Vertriebskonzept – auch Auftragnehmer sind) findet man häufig… nein, ich muss sagen, überwiegend die latente Furcht, ein Zuschlag könne allein dadurch gefährdet werden, dass man Vergabestellen gegenüber und etwaig konkret in Bezug auf ein Ausschreibungsobjekt Kritik an DIN 18041 ausführt. – Also akzeptiert man stillschweigend die Bedingungen jener Norm. Die etwas von Raumakustik verstehenm versuchen so leidlich, jene Schwierigkeiten in einem wettbewerbsfähigen Kostenrahmen abzudecken, die man dennoch sieht.
Für auftraggebende Stellen hat DIN 18041 inzwischen überwiegend einen solchen Rang und Ruf errungen, dass Ausschreibungen praktisch lückenlos und direkt mit dieser Norm verknüpft werden. Das wiederum wundert für die öffentliche Hand kaum: Wie wir vom DIN e. V. selbst erfahren, ist genau das Ziel der verbrieften Kooperation zwischen DIN e. V. und der Bundesregierung, öffentliche Stellen auf DIN-Normen einzuschwören.
Für die freie Wirtschaft darf das wundern, denn der Mangel an freiem Wettbewerb verteuert Projekte unnötig, die effektiver umgesetzt werden könnten, wenn man es etwaig bei dem Hinweis auf ASR A3.7 beließe.
Auf der Suche nach Erklärungen für eine solche Vergabepraxis stolpere ich so beiläufig wie zwangsläufig über Noelle-Neumann – und die Schweigespirale.
Das Schweigen ist eine Haltung geworden, die die Existenz sichert – und somit unternehmerisch nachvollziehbar ist und schwerlich angeprangert werden kann.
„Das Verhalten von Menschen unter Meinungsklimadruck ist denjenigen, die sich außerhalb der konkreten Situation befinden kaum verständlich“, so stellt Noelle-Neumann fest. (Noelle-Neumann, Elisabeth: Die Schweigespirale; Langen Müller, 2001 – Seite 349)
[…]
Leider klammert Noelle-Neumann sich beinahe verbissen daran, „öffentliche Meinung“ sehr umfassend zu betrachten und die Medien schlechthin als Meinungsbildner in jegliche Studie mit einzubeziehen, wenn es darum geht, die öffentliche Meinung als Druck auf Einzelne – und eben jene Schweigespirale – zu überprüfen. Aber gerade diese Schweigespirale ist sowohl Auswirkung als auch Instrument von sozialer Kontrolle: Auf unterschiedlichsten Ebenen wird durch das Erzwingen von Verschwiegenheit der Status Quo verteidigt. Derweil Noelle-Neumann so weit fasst und so umfassend schaut, droht die Bedeutsamkeit der „Schweige-Hypothese“ – wie Noelle-Neumann es benennt – eher übersehen zu werden.
Dabei wäre es vermutlich sogar für Wissenschaftler ebenso wie für jedermann einfacher zu akzeptieren, wenn Individuen sich dem sozialen Druck des selbstgewählten engeren Kontextes (sozusagen der eigenen „Subkultur“) beugen, als sich einzugestehen, dass man sich unweigerlich dem Druck der großen „öffentlichen Meinung“ unterwirft. Wer mag schon – sich selbst oder anderen – eingestehen, dass einem die „öffentliche Meinung“ eben nicht schnuppe ist? Und zugleich, je plakativer deklariert wird, wie sehr einen Druck und Meinung von Medien und Allgemeinheit egal seien, desto feinfühliger fällt die Ausrichtung des eigenen Schweigens oder Meinens am unmittelbaren Umfeld aus.
Der moderne Mensch sei frei und unabhängig und selbstbestimmt! … so das Credo der sich selbst als aufgeklärt darstellenden Gegenwartsbefindlichkeit. Und also: So und nicht anders möchte „man“ zeitgemäß sein und bitte auch so wahrgenommen werden: Unabhängig von dem, was andere Leute über einen denken. Mit der allzu strengen Auffassung von „öffentlicher Meinung“ verschenkt die Psychologie und hat auch Noelle-Neumann viel Erkenntnispotenzial verschenkt, wenn die „Öffentlichkeit“ nur das ganz große Publikum ist. […]
[…]
Hat man sich in ein Umfeld erst eingefunden, hat man sich eingebracht, hat man dadurch einen Platz errungen, so kann diese Bestätigung wiederum nur aufrechterhalten werden, indem man sich mit den Gegebenheiten abfindet und arrangiert. Der Golfclub oder der akademische Kreis unterscheidet sich in letzter Konsequenz überhaupt nicht von dem nachbarschaftlichen Umfeld […]. Tatsächlich bleibt nur die Flucht […] in das gesellschaftliche Ansehen. Was von außen kostbar schillert wie ein förderlicher Halt für den Einzelnen, das kann nach innen auch schnell ein (extrem) repressives System werden, dem das Individuum wiederum nur durch die Flucht nach vorn zu entrinnen vermag: durch mustergültige Anpassung.
Eines bleibt sich immer gleich: Die Währung für so etwas wie inneren Frieden ist die Anerkennung des Umfeldes – der Preis ist das Schweigen.
Der Kontext von „Öffentlichkeit“ – die für Subgesellschaften wohl lieber als „soziale Kontrolle“ beschrieben wird – beherrscht stets die Thematik. […]
Was Noelle-Neumann schreibt, liest sich vielleicht etwas speziell – ist aber vorzüglich getroffen, wenn man dem Versuch, Definitionen zu finden, die einhergehende Härte der Grenzziehung etwas nachsieht: Mit Definitionen werden auch stets Claims abgesteckt und schroffe Kantenabrisse erzeugt:
„Die vier Annahmen sind: 1. Die Gesellschaft gebraucht gegenüber abweichenden Individuen Isolationsdrohungen. 2. Die Individuen empfinden ständig Isolationsfurcht. 3. Aus Isolationsfurcht versuchen die Individuen ständig, das Meinungsklima einzuschätzen. 4. Das Ergebnis der Einschätzung beeinflusst ihr Verhalten vor allem in der Öffentlichkeit und insbesondere durch Zeigen oder Verbergen von Meinungen, zum Beispiel Reden oder Schweigen.“ (Noelle-Neumann, Elisabeth: Die Schweigespirale; Langen Müller, 2001 – Seite 299)
[…]
Es mag auch ernüchtern, jedoch kaum noch sonderlich überraschen, wenn Noelle-Neumann – keinesfalls zu Unrecht – Erik Zimen zitiert…
… der sich tief und intensiv mit Wölfen beschäftigt hatte. Erik Zimen hatte nicht nur für die Wölfe gelebt, sondern auch mit ihnen, gleichsam als Wolf auf zwei Beinen.
Nur auf den ersten Blick möchte nur etwas irritieren, dass Noelle-Neumann auch Wölfe in ihre Betrachtungen einbezieht. Auf den zweiten Blick versteht man, dass Wölfe recht ursprüngliche Sozialgemeinschaften bilden. Insoweit taugt vieles, das dem Wolf zueigen ist, um dem Menschen den Spiegel vorzuhalten.
„Für Wölfe ist“, so gibt Noelle-Neumann Erik Zimen wieder… „Für Wölfe ist das Heulen eines anderen Wolfes ein sehr starker Auslöser, selbst zu heulen […] Nicht immer aber zieht ein Einzelheulen den Chor nach sich. Das anfängliche Heulen eines rangniederen Wolfes z. B. ist seltener der Anlass als das eines ranghohen.“ (Noelle-Neumann, E.: Die Schweigespirale; Langen Müller, 2001 – Seite 139; aus: Zimen, E.: ‚Der Wolf: Mythos und Verhalten‘; Meyster, 1978)
Ernüchternd eben. Aber doch auch so sehr menschlich.«
Soweit Auszüge aus „Durch die Raumakustik muss ein Ruck gehen“, 2022; dort „Die Schweigespirale“, Seiten 508 – 535.